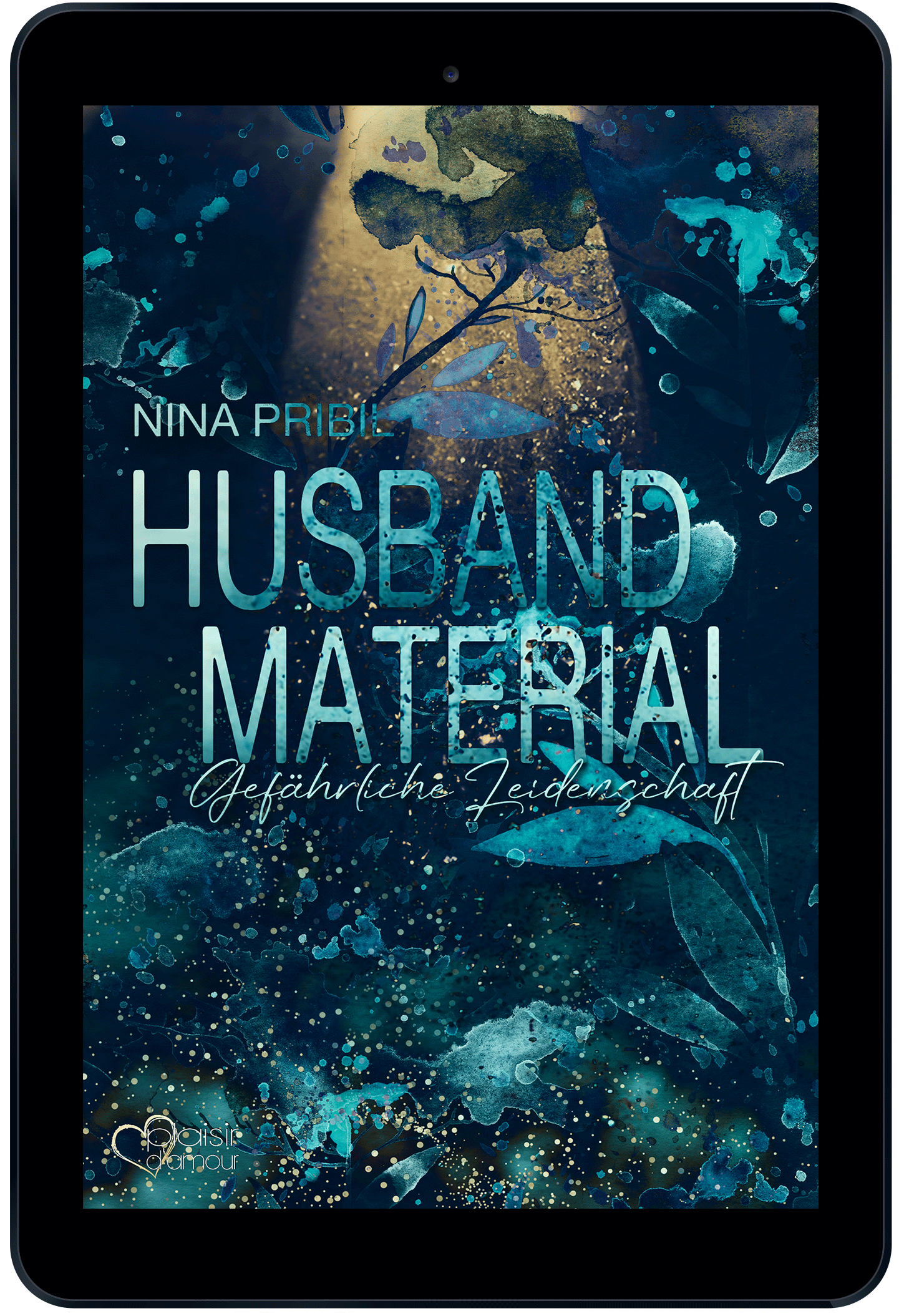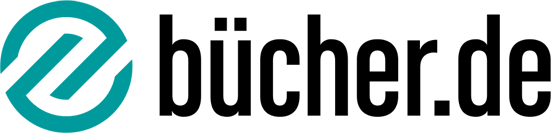paperback & ebook
Print: 978-3-86495-592-1
ebook: 978-3-86495-593-8
Print: 16,90 €[D]
ebook: 6,99 €[D]
Husband Material: Gefährliche Leidenschaft
Nina Pribil
Inhaltsangabe
Erschüttert vom tragischen Unfalltod ihrer Schwester, einer Schauspielerin, macht sich die alleinerziehende Olivia Green mit ihrer Tochter auf den Weg an die britische Nordseeküste, um den Nachlass zu regeln und um ihre Schwester zu trauern. Statt der erwarteten Idylle schlägt ihr jedoch Misstrauen entgegen, und Olivia wird von dem ebenso attraktiven wie ruppigen Fischer Henry Clarke als "raffgierige Journalistin" beschimpft, die Profit aus dem Autounfall ihrer Schwester schlagen wolle.
Was als Missverständnis beginnt, endet noch am selben Tag mit einem Orgasmus, der die aufgewühlte Olivia endgültig aus der Bahn wirft.
Henry, der sich von der hübschen jungen Frau angezogen fühlt und auf mehr hofft, schleicht sich unbemerkt und Stück für Stück in ihr Herz und ihr Leben. Gleichzeitig stellt Olivia fest, dass ihre Schwester ein dunkles Geheimnis hatte und ihr Tod vermutlich gar kein Unfall war.
Während Olivia nach der Wahrheit sucht, wird sie aus dem Schatten von einer unbekannten Bedrohung beobachtet, der die aktuelle Wendung gar nicht gefällt und weiterhin auf Rache sinnt. Wer trachtet nun auch nach Olivias Leben - und warum? Wem kann sie noch trauen?
Hat womöglich ausgerechnet der Mann, an den sie gerade erst ihr Herz verloren hat, etwas mit dem Tod ihrer Schwester zu tun?
Ein ebenso romantischer wie spannender Brit-Crime.
Über die Autorin
Nina Pribil wurde 1998 in Baden-Württemberg geboren und arbeitet als Gesundheits- und Krankenpflegerin in ihrer Heimat. Sie schreibt und liest romantische und fantastische Geschichten voller Abenteuer. Abgesehen davon findet man sie überall, wo Berge, Schokolade und Hunde sind. Zu ihren...
mehr über die Autorin erfahren
Leseprobe
„Kann ich Ihnen helfen?“
Unwillkürlich zuckte ich zusammen und richtete meine Aufmerksamkeit wieder auf die Bar. Ich war so tief in meinen Gedanken versunken, dass ich die Kellnerin vor mir gar nicht richtig bemerkt hatte. Eine junge Frau, ungefähr in meinem Alter, starrte mich ungeduldig an und plötzlich spürte ich die stechenden Blicke der anderen Gäste auf mir. Bis zu diesem Moment war mir überhaupt nicht aufgefallen, dass ich von allen angestarrt wurde. Ein beklemmendes Gefühl legte sich auf mich und ich spürte, wie die Unsicherheit schleichend Besitz von mir ergriff. Vielleicht war das hier doch keine so gute...
vollständige Leseprobe
...Idee gewesen. Ich wollte gerade auf dem Absatz kehrtmachen, als sich die Kellnerin ein weiteres Mal räusperte und meine Aufmerksamkeit somit wieder auf sich lenkte. Die Röte schoss mir ins Gesicht.
Verdammt, wie ich diese unbeholfene Seite an mir hasste.
Ich musterte die Frau vor mir. Ihr langes rotes Haar trug sie zu einem hohen Pferdeschwanz gebunden, der ihr trotzdem noch über die Brüste fiel. Sie war eher klein und zierlich, doch ich war mir sicher, dass sie es locker mit jedem der hier Anwesenden aufnehmen könnte. Sie sah nicht danach aus, als würde sie sich ansatzweise irgendetwas gefallen lassen. Und sie war auch nicht der Typ Frau, mit dem man sich anlegen wollte. Die Rothaarige steckte in einem etwas zu großen Kellnerinnen Outfit, welches ebenfalls in den Farben der Bellbird Hall leuchtete. Ich bemerkte, wie sie mit den Augen rollte, und stellte fest, dass ich weiterhin keinen Ton von mir gegeben hatte. Peinlich berührt räusperte ich mich kurz und nahm all meinen Mut zusammen. Das konnte doch nicht so schwer sein.
„Ähm, ja ... Hallo“, begann ich zu stottern und schob der Rothaarigen kurzerhand mein Smartphone über den Tresen. „Ich bin auf der Suche nach dieser Adresse hier und hoffe, dass Sie mir irgendwie weiterhelfen können. Als Tourist ist man hier ja komplett aufgeschmissen.“
Bei meinem letzten Satz zog die Kellnerin argwöhnisch ihre Augenbrauen zusammen. Innerlich verdrehte ich die Augen. Ich wusste nicht, warum, doch seit meiner Ankunft fühlte ich mich irgendwie eingeschüchtert und das gefiel mir ganz und gar nicht.
Überdeutlich spürte ich den Druck, der sich auf meine Schultern legte, und ich wagte es nicht, mich weiter umzusehen. Jeder Blick schien mich von oben bis unten auseinanderzunehmen und zu bewerten. Die Atmosphäre war so komplett anders als zu Hause in Canterbury. Die Leute dort waren aufgeschlossen, freundlich und hatten einen großartigen Humor. Um es einfacher auszudrücken, sie hatten definitiv keinen Stock im Arsch, so wie es hier der Fall zu sein schien.
Die Kellnerin musterte mich erneut und anhand ihres Blickes spürte ich die nahende Katastrophe, die im nächsten Moment schon auf mich zurollte. Die Rothaarige warf einen erneuten Blick auf mein Smartphone, räusperte sich kurz und lief anschließend drei Barhocker weiter. Mein Herz sackte nach unten und verkrampfte sich schlagartig. Was sollte das denn jetzt?
Ich wollte gerade etwas sagen, als ich den Mann bemerkte, der auf dem Barhocker saß. War mein Herz eben noch nach unten gesackt, so schnellte es jetzt in einem Satz wieder nach oben und schlug einen Salto nach dem anderen. Mein Mund war staubtrocken. Ich hatte in meinem Leben schon einige wirklich sehr gut aussehende Männer gesehen und kennengelernt, doch dieser hier übertraf sie alle. Er musste Anfang dreißig sein und war von großer, muskulöser Statur. Sein dunkles Haar fiel ihm in die Stirn und betonte seine hellgrauen Augen, die in ein strahlend helles Blau übergingen, sobald sein Blick auf mich fiel. Der Mann hatte einen gepflegten Dreitagebart und trug eine dunkelblaue Jeans, sowie ein dunkelgraues T-Shirt, welches perfekt zu seinen Augen passte. Kurzum, er war fleischgewordener Sex.
Ich musste schlucken und zwang mich, in eine andere Richtung zu sehen. Mein Herz schlug auf einmal unwahrscheinlich schnell und ich hatte das Gefühl, jeden Moment zu kollabieren. Hitze und Kälte wechselten sich in einem ungesunden Tempo miteinander ab und ich spürte, wie meine Handinnenflächen feucht wurden. Konnte man das Atmen vergessen? Hell, yes! Beinahe krampfhaft versuchte ich, mich wieder auf das hier und jetzt zu konzentrieren, doch es wollte mir nicht so recht gelingen. Die Farbe seiner Augen sowie der Schwung seiner Lippen ließen mich dahinschmelzen.
Die Rothaarige reichte ihm wie selbstverständlich mein Handy und er hielt inmitten seiner Bewegung inne. Sein zuvor entspannter Gesichtsausdruck wich augenblicklich einer wutverzerrten Fratze, was ihn leider nicht weniger attraktiv machte. Er ballte seine Hände zu Fäusten, gab der Frau das Smartphone zurück und schob seinen Hocker mit einem quietschenden Geräusch über den Steinboden. Automatisch wich ich einen Schritt zurück. Fuck. Was zur Hölle ging hier vor sich?
Der Mann mit den graublauen Augen kam Schritt für Schritt auf mich zu. Sein Gang war gefährlich elegant und trotz seiner ausstrahlenden Wut konnte ich meinen Blick nicht von ihm abwenden. Er faszinierte mich auf eine elektrisierende Art und Weise und ich spürte das Kribbeln, das sich in mir breitmachte und mich nicht mehr klar denken ließ.
„Was wollen Sie hier?“, knurrte er bedrohlich und ein kleiner Teil von mir fragte sich immer noch, wie man so sexy sein konnte. Seine Stimme war auffallend rau und ich reagierte wie ferngesteuert auf diesen Klang. Ein Schauer lief mir über den Rücken und ich spürte, wie das Kribbeln meinen Unterleib erreichte. Verdammt noch mal, seit wann tat mein Körper solche Dinge?
Ich räusperte mich, streckte meinen Rücken noch etwas mehr durch und nahm all meinen Mut zusammen.
„Wie gesagt, ich bin auf der Suche nach dieser Adresse hier.“
Zwanghaft versuchte ich, mich wieder zu beruhigen. Ich hatte schließlich nichts Falsches getan, also durfte ich die Kontrolle unter keinen Umständen verlieren. Auch wenn mein Gegenüber mir den Verstand raubte.
„Finden Sie das witzig?“ Die Frage war kaum mehr als ein Wispern, welches tief aus seiner Brust zu mir hervordrang. Sein ganzer Körper strotzte nur so vor Anspannung, sein Blick klebte an mir fest, raubte mir den Atem und ließ mich nicht mehr klar denken. Am liebsten würde ich vor lauter Frust und Wut in Tränen ausbrechen, doch das wollte ich auf keinen Fall. Nicht hier und schon gar nicht vor diesen Leuten. Diese Genugtuung gönnte ich ihnen nicht, also tat ich das einzig Vernünftige und trat den Rückzug an.
„Ich habe keine Ahnung, wovon Sie sprechen, aber ich werde jetzt wohl besser gehen.“ Ich kehrte ihm den Rücken zu, meine Hände zu Fäusten geballt und fixierte mit brennenden Augen den Ausgang. Ab wann hatte sich mein Leben in eine derartige Katastrophe verwandelt?
„Was ist nur los mit euch? Macht es euch so viel Spaß, einer Toten hinterherzuspionieren? Als hätten die Hinterbliebenen nicht schon genug mit ihrem Verlust zu kämpfen.“
Seine Stimme wurde nicht lauter, doch sie traf wie eine scharfe Klinge direkt in mein Herz. Er hatte einen Punkt getroffen, den er lieber nicht hätte treffen sollen. Ich blieb wie angewurzelt stehen und das Blut gefror mir in den Adern. Ich spürte eine aufsteigende Übelkeit, welche mir den Hals zuschnürte. Seine Worte dröhnten mir in den Ohren, und meine Hände fingen an zu zittern. Der ganze Raum begann sich zu drehen, während dieses verdammte Arschloch immer noch einen daraufsetzte. Der Mann hatte den Abstand zwischen uns verringert und inzwischen waren wir uns so nah, dass ich sein Rasierwasser riechen konnte. Um uns herum war es still geworden. Keiner der anderen Gäste wagte auch nur den kleinsten Laut und alle starrten gebannt zwischen mir und dem fremden Mann hin und her. Ich war mir nicht einmal mehr sicher, ob die Jukebox weiterhin die sanfte Musik von vorhin spielte oder nicht. Alle standen wie angewurzelt da und auch ich war wie festgefroren, unfähig zu handeln. Mein Verstand hatte sich verabschiedet und mein Herz versuchte verzweifelt, mich vor weiteren Attacken meines Gegenübers zu schützen.
„Wie viel wurde Ihnen denn für diese Story geboten? Bekommen Sie für Bilder vielleicht sogar das Doppelte?“
Warum hörte er nicht einfach auf zu reden? Stumm hatte er mir deutlich besser gefallen. Ich war mir sicher, wenn ich jetzt nach oben blickte, wäre ich nur wenige Zentimeter von seinem Gesicht entfernt. Seine Nähe und die Hitze, die von ihm ausging, machten mich nicht gerade auf eine angenehme Art und Weise nervös. So attraktiv ich ihn auch fand, so wütend machte mich in diesem Moment sein Anblick.
Ich schluckte, schloss meine Augen, atmete tief ein und aus, doch das Gefühlschaos in meinem Inneren beherrschte momentan alles. Wut, gepaart mit Angst, kämpfte gegen Fassungslosigkeit. Ich kämpfte gegen die aufsteigenden Tränen an. Ich musste hier auf der Stelle raus, sonst könnte ich für nichts mehr garantieren. Ein letztes Mal ließ ich meinen Blick nach oben wandern, bis sich unsere Blicke kreuzten. Braun begegnete Blau. Da war etwas zwischen uns, das ich nicht deuten konnte. Doch zwischen all der Wut und all dem Hass konnte ich erkennen, dass sein Körper ebenso sehr auf meinen Körper reagierte wie umgekehrt. Sein Oberkörper war mir zugewandt und seine Finger zuckten kaum merklich in meine Richtung. Ich bemerkte das Hüpfen seines Adamsapfels jedes Mal, wenn er schlucken musste, um seine Kehle zu befeuchten. Seine Pupillen waren erweitert und verdrängten das wunderschöne Blau, das mich so sehr an das Meer vor der Tür erinnerte. Ich konnte die feinen Adern an seinen Unterarmen erkennen, die sich bis zu seinen Händen erstreckten. Mein Unterleib zog sich zusammen, als ich daran dachte, wie sie sich wohl auf meiner Haut anfühlten. Mein Körper war ein mieser, kleiner Verräter.
„Ihre falschen Anschuldigungen können Sie sich sonst wohin stecken“, zischte ich und hatte keine Ahnung, woher ich plötzlich meinen Mut genommen hatte. „Gabby hat uns, ihre Familie, von sich gestoßen, doch irgendjemand muss sich ja um ihre Angelegenheiten kümmern. Und glauben Sie mir, das ist alles andere als leicht, wenn man seine große Schwester so gut wie nie gesehen hat.“ Meine Stimme versagte von Wort zu Wort immer mehr und das Wort Schwester spuckte ich ihm beinahe kläglich krächzend entgegen. Ich wischte mir eine Träne aus dem Augenwinkel und starrte ihn hasserfüllt an. Meine Unterlippe bebte und ich zitterte am ganzen Körper.
„Das erklärt dann wohl auch, warum Sie Gabby hier nie besucht haben“, hörte ich plötzlich die Kellnerin sagen.
Sie hatte recht und inzwischen verstand ich, warum mich alle so angestarrt hatten. Weder ich noch meine Eltern hatten Gabby jemals in der Bucht besucht. Sie hatte uns von sich gestoßen und uns ausgeschlossen. Niemand hier kannte uns. Hier waren wir kein Teil ihres Lebens.
Allmählich fand ich meine Stimme wieder. „Wenn Sie mich nun entschuldigen würden. Meine Tochter und ich sind eben erst angekommen und es war eine wirklich lange Fahrt. Vielen Dank für Ihre Gastfreundschaft.“
Ich deutete eine spöttische Verbeugung an, denn ich wollte mir meinen letzten Funken Stolz nicht nehmen lassen. Doch anschließend sackten meine Schultern kraftlos nach unten. Ich war so unendlich müde und hatte keine Geduld mehr, mich weiterhin erklären zu müssen.
Der Mann, der mir eben noch so nahe gewesen war, riss nun seine Augen auf, blickte mich entsetzt an und taumelte ein paar Schritte zurück. Sein perfekter Mund stand offen und für einen Moment sah es so aus, als wüsste er nicht, was er zu seiner Verteidigung sagen sollte.
Ja, Überraschung. Die Betroffenheit stand ihm deutlich ins Gesicht geschrieben, doch das war mir in diesem Moment vollkommen egal. Sollte er sich ruhig schuldig fühlen. Ich sah mich ein letztes Mal um und kämpfte gegen die Panik in meinem Inneren an. Die Menschen um mich herum hatten ihre Blicke gesenkt oder starrten konsequent in die entgegengesetzte Richtung. Die Show war vorbei und jeder von ihnen peinlich berührt.
„Ich wusste nicht ...“ Sein Blick war beinahe flehend, doch ich funkelte ihn an, als er einen Schritt auf mich zu machte. Augenblicklich blieb er stehen. Er hatte verstanden. „Es tut mir unfassbar leid.“
Ich lachte freudlos auf und schüttelte den Kopf. „Halten Sie sich von mir und meiner Familie fern.“
Meine Worte klangen erstaunlich fest und ich knallte ihm meine angestauten Gefühle direkt an den Kopf. Meine ganze Wut sowie der grenzenlose Schmerz verfehlten ihr Ziel keineswegs. Beschämt senkte der Mann seinen Blick und biss sich auf die Unterlippe. Ohne einen weiteren Kommentar wirbelte ich herum, marschierte zielstrebig in Richtung Ausgang, als ich schwere Schritte hinter mir hörte. Ich beschleunigte das Tempo und sprang die Stufen zum Parkplatz hinunter.
Ich benötigte zwei Anläufe, doch schließlich gelang es mir, mit zittrigen Fingern den Autoschlüssel aus meiner Hosentasche zu angeln und den Wagen zu entriegeln. Erleichtert ließ ich mich auf den Fahrersitz fallen und schlug die Tür zu. Plötzlich schreckte Ella auf und sah sich vollkommen verdattert um. Vorsichtshalber sperrte ich das Auto von innen ab und legte gleichzeitig den Rückwärtsgang ein. Ich hatte keine Lust auf eine weitere Begegnung mit diesem Irren. Wobei ich mir leider eingestehen musste, dass ich anfangs noch ziemlich viele dumme Ideen hatte, die ihn miteinschlossen. Doch dieser Hormonschub war ebenso schnell vorbei, wie er gekommen war. Der feuchte Kies knirschte unter den anfahrenden Rädern und unzählige kleine Steinchen stoben in alle Richtungen davon.
„Was ist denn los, Mum? Warum weinst du?“
Die sanfte Stimme meiner Tochter war voller Sorge und ich bekam automatisch ein schlechtes Gewissen. Ich hatte Ella nicht so erschrecken wollen. Schnell wischte ich mir die Tränen aus dem Gesicht und warf einen Blick in den Rückspiegel. Der Mann im grauen T-Shirt stand mitten auf dem Parkplatz und sah uns hinterher. Ich schüttelte den Kopf, wischte mir die Tränen aus dem Gesicht und zwang mich zu einem Lächeln. Ich hatte gar nicht bemerkt, dass ich geweint hatte.
„Alles gut, Jellybean. Ich wollte dich nicht erschrecken, entschuldige.“
Ella runzelte die Stirn, sagte jedoch nichts mehr. Sie glaubte mir nicht und daraufhin fühlte ich mich noch schlechter. Doch war es überhaupt eine Lüge, wenn man sein Kind damit nur beschützen wollte?
Bereits an der nächsten Kreuzung stellte ich fest, dass ich mein Handy vergessen hatte. Die rothaarige Kellnerin hatte es zuletzt in ihren Händen gehabt und kurz überlegte ich, ob ich wieder umkehren sollte, um es zu holen. Nach einigem Hin und Her entschied ich mich dagegen. Nichts auf der Welt würde mich heute noch dazu bringen, erneut mit diesen Leuten zu sprechen. Vielleicht morgen oder übermorgen, aber ganz sicher nicht heute. Dafür hatte ich keine Kraft mehr und schlagartig kehrte die Wut wieder zurück. Es war, als hätte sie meinen Körper nie ganz verlassen.
Ich hatte es so satt. Ich wollte mich nicht mehr verteidigen oder rechtfertigen müssen. Wochen zuvor war meine große Schwester bei einem tragischen Autounfall ums Leben gekommen. Ihr Auto hatte eine Leitplanke durchbrochen und war mehrere Hundert Meter in die Tiefe gestürzt. Seitdem war die Hölle über mich und meine Familie hereingebrochen. Die polizeilichen Ermittlungen waren nur der Anfang gewesen, doch was danach kam, war an Grausamkeit nicht zu überbieten. Der Verlust eines geliebten Menschen war immer schlimm. Doch der plötzliche Tod einer erfolgreichen, jungen Schauspielerin, die von Millionen Menschen geliebt und gefeiert wurde, war etwas ganz anderes. Man war mit seiner Trauer nicht mehr allein, sondern jeder schien besser über meine Schwester Gabby Bescheid zu wissen als ihre eigene Familie. Und wahrscheinlich traf das auf sehr viele Dinge zu, von denen wir einfach nichts wussten. Ihr Haus hier in der Bucht war der beste Beweis für unser zerrüttetes Verhältnis.
Die sozialen Medien hatten den tragischen Unfalltod meiner Schwester von vorne bis hinten ausgeschlachtet. Wir hatten nicht einmal die Chance gehabt, uns gebührend von Gabby zu verabschieden, denn die Fotografen und ihre Fans lauerten überall. Menschen, deren Namen ich noch nicht einmal kannte, riefen zu jeder Tages- und Nachtzeit an. Familienmitglieder und Nachbarn kondolierten, während wildfremde Menschen unangebrachte Fragen über die laufenden Ermittlungen stellten. Warum konnte man uns nicht einfach in Ruhe lassen und warum fühlte sich plötzlich jeder angesprochen? Wir hatten es verdient, trauern zu dürfen. In Ruhe und in Würde. Doch das war diesen Leuten anscheinend vollkommen egal.
Ich atmete noch einmal tief durch und überlegte, was ich als Nächstes tun sollte. Ich durfte keine Schwäche zeigen und musste stark bleiben. Wenn nicht für mich, dann zumindest für meine Tochter. Ich hatte immer noch keine Ahnung, wo Gabbys Haus zu finden war, als mein Blick auf zwei Passanten fiel. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite wartete ein altes Ehepaar, die mein Auto musterten und miteinander zu diskutieren schienen. Ich zögerte einen kurzen Moment und ließ anschließend das Fenster herunter, um das Ehepaar nach dem Weg zu fragen.
„Entschuldigen Sie“, sagte ich und bemühte mich, um einen freundlichen Ton. „Ich bin auf der Suche nach dem Haus von Gabby Green. Ich bin ihre Schwester, Olivia.“
Die Eheleute sahen einander verdutzt an. Die alte Frau wollte gerade zu einer Antwort ansetzen, als ihr Mann dazwischenfunkte. „Können Sie das denn auch beweisen, junge Dame? In letzter Zeit waren hier öfter irgendwelche Fremden, die sich als Familienangehörige ausgegeben haben.“
Bei Familienangehörigen malte er imaginäre Anführungszeichen in die Luft und innerlich rollte ich mit den Augen. Natürlich, bestimmt hatte es hier nur so von Presseleuten gewimmelt. Ich hatte bereits in meiner Kindheit erfahren, dass es immer wieder Menschen gab, die versuchten, sich an meiner Familie zu bereichern. Diese Tatsache war der Karriere meiner Schwester geschuldet. Was mit der Theater-AG in der Schule begonnen hatte, führte zu nationaler und internationaler Bekanntheit. Schon immer hatte ich mich gefragt, ob es daran gelegen hatte, dass sie ihrer Familie den Rücken gekehrt hatte. Doch bis heute waren weder ich noch meine Eltern zu einer Antwort gelangt.
„Aber, Jack, das ist doch nicht nötig“, mischte sich nun seine Frau ein und holte mich somit zurück ins hier und jetzt. Auf ihren Lippen lag ein vorsichtiges Lächeln und ich stellte fest, dass das heute die erste freundliche Geste war, die man mir entgegenbrachte.
„Das ist schon in Ordnung, warten Sie.“ Zaghaft erwiderte ich ihr Lächeln und zog hastig meinen Geldbeutel hervor. Ich reichte dem Ehepaar meinen Ausweis und der Mann begutachtete mit einem prüfenden Blick das Dokument. Wahrscheinlich wusste er noch nicht einmal, wonach er genau suchen musste, um eine Fälschung zu erkennen. Doch solange ihm der Ausweis die nötige Sicherheit vermittelte, um mir den richtigen Weg zu zeigen, sollte es mir recht sein.
„Nun, das scheint alles seine Richtigkeit zu haben“, sagte er schließlich und beendete damit seine Inspektion.
Da habe ich aber noch einmal Glück gehabt, dachte ich zynisch und steckte das kleine Dokument zurück in meinen Geldbeutel. Das Ehepaar startete mit der Wegbeschreibung und verfiel schon bald in einen charmanten Wechselgesang.
„Sie bleiben auf dieser Straße, bis Sie das Ortsschild hinter sich gelassen haben.“ Der Mann räusperte sich.
„Und gleich danach geht ein beinahe unscheinbarer Weg rechts ab. Das ist doch richtig, oder, Jack?“
„Korrekt, Liebling. Gabbys Haus liegt direkt am Strand und ...“
„... deshalb kann man es von der Straße aus nicht direkt sehen. Fahren Sie einfach direkt auf das Meer zu, dann können Sie es eigentlich nicht verfehlen“, endete die Frau und nickte selbstzufrieden.
Unwillkürlich musste ich grinsen und bedankte mich bei den Eheleuten. Die beiden waren offensichtlich ein eingespieltes Team und für einen kurzen Augenblick wurde ich von einer tiefen Sehnsucht erfüllt, denn genau das war mein größter Wunsch.
Ich wollte gerade wieder das Fenster schließen, als die Frau mich zurückhielt.
„Wir bedauern Ihren Verlust außerordentlich. Gabby war eine so umwerfende junge Frau.“
Meine Kehle zog sich schmerzhaft zusammen, wie immer, wenn es um meine ältere Schwester ging, die viel zu früh ihr Leben verloren hatte. Ich blinzelte gegen die Tränen an und zwang mich zu einem Lächeln, nicht fähig, irgendetwas zu erwidern. Das Ehepaar winkte uns zum Abschied noch einmal zu. Sie schienen meinen Schmerz vielleicht nicht zu begreifen, doch sie hatten ihn erkannt und waren mir mit Freundlichkeit und Mitgefühl begegnet. Ein winzig kleiner Stein fiel von meiner Brust und gleichzeitig spürte ich die Aufregung durch meine Adern rauschen. Schon bald würde ich zum ersten Mal das Zuhause meiner Schwester sehen.
Dank der Wegbeschreibung gelangten wir ohne weitere Zwischenfälle an unser Ziel. Ella drückte sich ihre Nase an der Scheibe platt, denn sie war noch aufgeregter als ich und konnte es kaum erwarten, die Gegend zu erkunden. Gemeinsam stiegen wir aus dem stehenden Fahrzeug und salzige Meeresluft schlug uns entgegen.
Das Haus vor uns war mehr als beeindruckend und ich verstand augenblicklich, warum Gabby sich hier so wohlgefühlt hatte. Das dunkelblaue Haus mit den weißen Fensterrahmen lag direkt am Meer, inmitten der weitläufigen Dünen, und strahlte eine unglaubliche Wärme aus. Es bestand aus einem großen Haupthaus und einem etwas kleineren Anbau. Ein steinerner Kamin ragte in den wolkenverhangenen Himmel und ein Meer aus grünem Strandhafer schien das Haus sanft einzuschließen, ganz so, als würde es schweben. Seemöwen kreisten über unseren Köpfen und stießen kreischende Laute aus. Es klang mehr nach einem Lachen und ich fragte mich, ob das wohl das Begrüßungskomitee war.
„Wow“, flüsterte Ella leise und ich stimmte ihr wortlos zu. Dieser Ort war einfach atemberaubend schön, passend zu Gabby. Hatte gepasst, verbesserte ich mich in Gedanken.
„Möchtest du aufschließen?“, fragte ich. „Dann sehen wir es uns von Innen an.“
Ella nickte strahlend und nahm mir den Schlüssel aus der Hand. Sie hüpfte die wenigen Stufen bis zur Haustür hinauf und ich folgte ihr langsam. Plötzlich spürte ich ein ungutes Ziehen in meiner Magengegend und runzelte die Stirn. Normalerweise konnte ich mich immer auf mein Bauchgefühl verlassen und spürte, wenn etwas nicht stimmte. Aber diesmal schob ich das ungute Gefühl auf den Stress der letzten Tage und wischte die dunklen Gedanken, so gut es ging, beiseite. Ella hatte die Haustür bereits aufgeschlossen und war im Inneren des Hauses verschwunden. Ich blieb auf der Schwelle der Tür stehen und zögerte noch einen Augenblick. Die Beerdigung war nun vier Wochen her, der Unfall beinahe schon sechs. Ich hatte lange mit meinen Eltern gesprochen und schließlich hatten wir uns darauf geeinigt, dass ich mich um das Haus in Hiraeth Bay kümmern sollte. Der Tod ihrer ältesten Tochter hatte meine Eltern zutiefst erschüttert und ich war mir nicht sicher, ob sie sich jemals wieder von diesem Verlust erholen würden. Genau aus diesem Grund hatte ich mich freiwillig angeboten, hierher zu fahren. Ich wollte mich um die verbliebenen Angelegenheiten meiner großen Schwester kümmern. Das Haus musste ausgeräumt werden und ein Käufer oder Mieter gefunden werden. Meine Eltern wollten das Strandhaus so schnell wie möglich unter den Hammer bringen. Ich konnte es ihnen nicht verübeln. Aus den Augen aus dem Sinn. Als würde der Schmerz, den so ein Verlust mit sich brachte, dann einfach so verschwinden.
„Mum! Komm endlich und sieh dir das an!“ Ellas Stimme riss mich aus meinen Gedanken.
Ich konnte sie nirgendwo entdecken, doch ihrer Stimme zufolge musste sie sich irgendwo im Erdgeschoss befinden. Leise betrat ich das Haus und fand mich in einem hellen Flur wieder. Wärme, gepaart mit ein klein wenig Unbehagen, machte sich in mir breit. Auf der einen Seite des Flurs befand sich eine helle Garderobe mit dunklen Kleiderhaken, auf der gegenüberliegenden Seite hingen gerahmte Bilder an den Wänden und über mir hing ein geschmackvoller Kronleuchter. Ich trat zur Wand mit den Bildern und entdeckte mich dort selbst. Es war der Tag meiner Examensfeier gewesen und ich hob triumphierend ein Sektglas in Richtung Kamera. Daneben hing ein Bild von Ella, welches kurz nach ihrer Geburt entstanden war. Meine Augen wurden glasig und ich betrachtete das nächste Bild - ein Familienporträt. Wir Schwestern hatten unseren Eltern zum Hochzeitstag ein Fotoshooting geschenkt und das war das Ergebnis. Es war das letzte gemeinsame Geschenk gewesen, bevor Gabby bei uns ausgezogen war. Danach hatten wir nur sehr selten miteinander telefoniert, bis der Kontakt schließlich ganz abgebrochen war. Es berührte mich, dass sie trotz allem an uns gedacht hatte und unsere Bilder aufgehängt hatte. All das schien vor so langer Zeit passiert zu sein, es wirkte beinahe unwirklich.
Ich setzte meine Tour durch das Haus fort, trat durch eine Tür auf der linken Seite und stand in einem großen, offenen Wohnzimmer. Es war hell, freundlich und mit gemütlichen Möbeln ausgestattet. Eine Wand bestand komplett aus Natursteinen und zwischen den Fugen traten die unterschiedlichsten Grünpflanzen hervor. Es war unglaublich schön und ich war auf Anhieb fasziniert. Gabby hatte sich die Natur einfach in ihr Haus geholt und etwas so Lebendiges erschaffen, dass es mich sofort traurig stimmte, dass sie das alles hier nicht weiter genießen konnte, sondern ich. Mein Blick wanderte nach oben. Auch hier entdeckte ich einen Kronleuchter an der Decke und war mir sicher, dass dieses Detail sich auch in den anderen Räumen fortsetzen würde. Der Raum wurde durch eine gigantische Sitzlounge dominiert, welche mit einer Vielzahl an Kissen und Decken dekoriert worden war. Ein weiteres Highlight war der offene Kamin inmitten der Wand. Jede Ecke dieses Hauses schrie geradezu nach meiner großen Schwester. Gabby hatte die Kreativität unserer Mutter geerbt und war eine leidenschaftliche Fotografin gewesen. Nur sie allein schaffte es, Dinge mithilfe ihres Objektivs zum Leben zu erwecken. Ihre Werke schienen selbst nach so langer Zeit noch eine Geschichte zu erzählen.
Ich trat zurück in den Flur und lief den Gang hinunter. Es war ein sich immer wiederholendes Muster. Bilder. Pflanzen. Noch mehr Bilder und noch mehr Pflanzen. Ich musste beinahe grinsen, als ich den Kronleuchter in der Küche sah. Diese war im skandinavischen Stil errichtet worden. Helles Parkett, weiße Einbauschränke und eine helle Arbeitsplatte aus Holz. Sie war offen, groß und auch hier konnte ich ein paar Pflanzen in Form von Gewürzen und Kräutern entdecken. Rosmarin, Petersilie, Oregano, sowie mehrere reife Peperoni. Gabby hatte scharfes Essen geliebt, zumindest war das früher einmal so gewesen.
Neben der Küche befand sich ein separater Essbereich mit einem schönen massiven Holztisch und den passenden Stühlen. Ich drehte der Küche den Rücken zu und machte mich auf den Weg in das Nebengebäude. Dort rechnete ich mit den Schlafzimmern und Bädern, doch das Nebengebäude hatte weder eine Raumaufteilung, noch war es mehrstöckig. Es war ein einzelner Raum. Groß, hoch, mit hellen, verspiegelten Wänden und dunklen Holzbalken an der Decke. Es war ein gigantischer Wintergarten mit einem uneingeschränkten Blick auf das tosende Meer. Die goldenen Spiegel verliehen dem Raum noch mehr Weite und Größe, als wäre das überhaupt noch möglich. Der Wintergarten wurde ebenfalls von einer weitläufigen Sitzlounge eingenommen. Diese war jedoch mit künstlichen Fellen und mehreren Deko-Kissen ausgestattet. In die Wände waren mehrere Bücherregale eingelassen, die von den Spiegeln reflektiert wurden. Von den Dachbalken hingen mehrere Makramee-Pflanzennetze und ich wusste, dass Gabby diese selbst geknüpft hatte. Makramee war ein weiteres, heimliches Talent meiner Schwester. Gewesen.
Die verschiedenen Grüntöne der Pflanzen gaben dem Raum etwas Aufregendes, aber auch Gemütliches. Ich kam aus dem Staunen gar nicht mehr heraus, denn Gabby hatte sich mit jedem Detail selbst übertroffen und ihre Kreativität kannte offensichtlich keine Grenzen. Seufzend wandte ich mich ab, ließ die Tür zum Wintergarten offen stehen und machte mich auf die Suche nach meiner Tochter. Ich fand Ella auf der Terrasse hinter dem Haus. Sie saß vor einem Berg Salat und Gemüse und strahlte.
„Na, wie gefällt es dir hier?“, fragte ich und ließ mich neben ihr nieder. „Hat Mister Sam die Reise gut überstanden?“
„Es ist total cool hier!“, antwortete sie und strich der kleinen Landschildkröte liebevoll über den braungrünen Panzer. „Ihm gefällt es, glaube ich, auch.“
Mister Sam kam aus einem Tierheim. Er war ohne Futter und Wasser in einem Schuhkarton ausgesetzt worden. Ella hatte sich schon immer ein Haustier gewünscht und da ein Hund aufgrund des Platzmangels in unserer Wohnung und dem fehlenden Garten nicht möglich gewesen war, hatten wir uns anderweitig umsehen müssen. Die Suche gestaltete sich etwas schwierig, denn Ella hatte meine Katzenhaarallergie geerbt und Angst vor Vögeln. Ich weigerte mich, über Schlangen, Geckos oder sonstige Exoten nachzudenken. Es musste also ein Tier sein, um das wir uns beide adäquat kümmern konnten, ohne einen allergischen Schock oder eine Panikattacke zu erleiden. Mister Sam war ein Glücksgriff gewesen und wir hatten uns direkt in den süßen Kerl verliebt. Ich war stolz auf meine Tochter, denn sie kümmerte sich wirklich liebevoll um das kleine Tier. Und jedes Mal, wenn ich sie so glücklich erlebte wie jetzt, wusste ich, dass wir genau die richtige Entscheidung getroffen hatten.
„Hast du dir schon dein Zimmer ausgesucht?“, fragte ich und Ella nickte abwesend. Sie war zu beschäftigt, auf ihre Finger zu achten, während Mister Sam eifrig an einem kleinen Stück Gurke herumnagte und dabei ihren Fingern gefährlich nahekam.
„Ich werde mal unsere Sachen aus dem Auto holen, okay?“
Ella nickte und damit ließ ich meine Tochter auf der Terrasse zurück. Sie sollte sich nach der langen Anreise erholen, denn die letzten Wochen waren auch für sie eine wahre Achterbahnfahrt gewesen. Die Trauer und die Menschenmassen, die uns auf Schritt und Tritt verfolgten, gingen auch an ihr nicht spurlos vorbei. Kurzzeitig hatte ich sogar überlegt, Ella von ihrer Schule zu nehmen, nachdem sich ein Reporter Zutritt zum Schulgelände verschafft hatte. Alles nur, um an Infos über Gabby zu gelangen.
Ich startete mit den Lebensmitteln, die ich für die lange Fahrt in einer Kühltasche deponiert hatte. Nachdem ich alle abgelaufenen sowie verschimmelten Lebensmittel aus Gabbys Kühlschrank entfernt hatte, putzte ich ihn einmal durch und räumte anschließend alles Frische wieder ein. Daraufhin holte ich die restlichen Koffer aus dem Wagen. Ella kam nun ebenfalls nach oben und machte sich in ihrem Zimmer breit. Sie würde im Gästezimmer mit dem dazugehörigen Balkon schlafen.
„Soll ich dir beim Auspacken helfen, Jellybean?“
„Das schaffe ich alleine, aber so langsam bekomme ich Hunger“, antwortete Ella und auch ich konnte die Leere in meinem Magen nicht länger leugnen.
„Wir packen unsere Koffer aus und dann koch ich uns etwas Schönes, ist das ein Plan?“
„Pizza oder Makkaroni?“ Ella legte ihren Kopf schräg, als würde sie über die Entstehung des Universums nachdenken. Ich konnte sie verstehen, denn wenn es ums Essen ging, verstand keiner von uns beiden Spaß.
„Heute Pizza und morgen Makkaroni?“
„Das ist ein guter Plan.“ Ella grinste und wollte gerade zurück in ihr Zimmer, als sie sich noch einmal umdrehte. „Mum?“
„Ja?“
„Denkst du, Tante Gabby findet es gut, dass wir jetzt hier sind?“
Prompt kehrte der Kloß in meiner Kehle wieder zurück. Ich schluckte krampfhaft dagegen an, als ich die Unsicherheit in ihren Augen erkannte. Natürlich konnte ich Ella verstehen, denn auch ich hatte oft daran denken müssen, was meine Schwester wohl von alldem halten würde. Wir hatten uns noch nie nahegestanden und das hatte sich nach Ellas Geburt auch nicht geändert. Ganz im Gegenteil. Gabby hatte mich zwar nie verurteilt, dass ich mit sechzehn Mutter wurde, doch sie hatte auch nichts getan, um mir während der Schwangerschaft und in der Zeit danach beizustehen. Ich war ihr deswegen nie böse gewesen. Gabby und ich waren einfach komplett verschieden gewesen und das war auch okay so. Doch manchmal hätte ich mir ein besseres Verhältnis zu meiner Schwester gewünscht. Es war nicht so, dass ich es nicht versucht hatte. All die unzähligen Nachrichten und Anrufe, auf die ich keine Antwort erhalten hatte. Gabby hatte mir nie zurückgeschrieben und all meine Anrufe ignoriert. Doch manchmal wünschte ich mir, dass ich hartnäckiger geblieben wäre. Vielleicht hätte Gabby mir dann erklärt, warum sie uns den Rücken gekehrt hatte.
Meine Schwester hätte trotzdem nichts gegen unseren Aufenthalt, da war ich mir sicher. Sie würde wollen, dass ihr Haus in die richtigen Hände fiel und man sich darum kümmerte.
„Gabby hat uns geliebt, weißt du“, sagte ich, und versuchte, Ella ihre Unsicherheit zu nehmen. „Sie würde wollen, dass wir uns jetzt um ihr Haus kümmern. Mach dir keine Gedanken, mein Schatz. Es ist alles in Ordnung.“
Ella blinzelte und nickte schließlich. „Ich hab dich lieb, Mummy.“
„Ich hab dich auch lieb“, antwortete ich lächelnd und gab ihr einen Kuss auf die Stirn. „Und jetzt los, damit wir schnell fertig werden.“
Mit einem mulmigen Gefühl betrat ich das Schlafzimmer meiner verstorbenen Schwester. Es war so ähnlich eingerichtet wie der Rest der Wohnung. Hell, offen und freundlich, ein Kronleuchter an der Decke und dunkles Parkett am Boden. Den meisten Platz nahm das graue Boxspringbett mit weißer Bettwäsche und dunkelgrauer Tagesdecke ein. Über dem Bett hing eine gigantische Landkarte der britischen Nordseeküste. Sie war äußerst filigran und sehr genau von Hand gezeichnet. An der gegenüberliegenden Wand befand sich ein weiß gestrichener Kleiderschrank, der sich über die gesamte Länge erstreckte. Der Kleiderschrank war noch voll mit Gabbys Sachen. Es fühlte sich falsch an, die Kleidung meiner Schwester durch meine eigene zu ersetzen, also nahm ich mir vor, erst einmal im Wohnzimmer zu übernachten.
Vom Schlafzimmer aus gelangte man direkt in das angrenzende Badezimmer. Das Highlight dort war eine frei stehende Badewanne in der Mitte des Raumes. Weißer Stein an den Wänden sowie am Boden, goldene Elemente, zwei Waschbecken und ein großer, beleuchteter Spiegel, der sich fast über die ganze Wand erstreckte, befanden sich ebenfalls im Raum. Wie oft hatte Gabby sich wohl in diesem Spiegel betrachtet und sich über ihre Frisur oder einen misslungenen Lidstrich geärgert? Alles an diesem Haus war ordentlich und sauber. Die Zahnbürste und die Zahnpasta befanden sich rechts davon in einem Glas, links stand der Seifenspender. Zwei frische Handtücher hingen über der Duschkabine und der Wäschekorb, gleich neben der Tür, war voll. Alles schien darauf zu warten, dass meine Schwester jeden Moment wieder zurückkam. Doch das würde sie nicht. Nie wieder.
Ich sah noch einmal kurz nach meiner Tochter, bevor ich mich auf den Weg nach unten machte. Ella war noch immer mit Auspacken beschäftigt und dabei wollte ich sie nicht stören. Ich betrat die Küche und suchte mir die Zutaten zusammen, die ich für die Pizza benötigte. Der Teig war schnell gemacht und ich deckte die Schüssel mit einem Geschirrtuch ab, um den Teig noch etwas gehen zu lassen. Währenddessen rührte ich die Tomatensoße an und suchte anschließend nach einem Schneidebrett, um das Gemüse für den Belag vorzubereiten. Ich öffnete diverse Schubladen, wurde jedoch nicht fündig.
Mein Blick fiel auf ein geschlossenes Fach unterhalb des Kühlschranks. Mit einem Ruck zog ich die Schublade auf und stolperte augenblicklich zurück. Entsetzt presste ich mir die Hand auf den Mund, um den aufsteigenden Schrei in meiner Kehle zu ersticken. Vorsichtig lugte ich erneut in die Schublade. Eine Schusswaffe lag in der geöffneten Schublade, deren Anblick sich in meine Augen brannte. War sie vielleicht sogar geladen? Ich hatte keine Ahnung, denn ich kannte mich mit so etwas nicht aus. Warum hatte Gabby eine Waffe im Haus? Sie wirkte hier so fehl am Platz. Entschlossen knallte ich die Schublade wieder zu, riss sie jedoch im selben Augenblick wieder auf. Das Ding musste hier weg, und zwar so schnell wie möglich. Die Schublade konnte man jederzeit öffnen und ich musste verhindern, dass die Waffe in Ellas Hände fiel. Eine Waffe hatte nichts in einem Haus mit einem Kind verloren.
Fieberhaft suchte ich nach einem passenden Versteck und dabei fiel mir das Nachtkästchen in Gabbys Schlafzimmer ein. Eine bessere Idee hatte ich auf die Schnelle nicht. Darum würde ich mich später kümmern müssen. Jetzt war es erst einmal wichtig, dass Ella nichts von alledem mitbekam. Mit zittrigen Fingern nahm ich ein frisches Geschirrtuch aus dem Regal und wickelte den Revolver vorsichtig darin ein. Gerade wollte ich die Schublade wieder schließen, als ich polternde Schritte auf der Treppe hörte. Erschrocken fuhr ich herum. Ella.
„Fuck, Fuck, Fuck“, wisperte ich panisch, während ich den eingewickelten Revolver zurück in die offene Schublade fallen ließ und die Schublade wieder zudrückte. Gerade noch rechtzeitig, denn Ella hüpfte bereits in die Küche und war offensichtlich bereit für das Abendessen. Ich zitterte am ganzen Körper und versuchte krampfhaft, meine Gedanken zu ordnen. Was war das nur für ein abgefuckter Tag? Sobald Ella im Bett war, würde ich den Revolver verstecken, doch wenn ich mich nicht schnell wieder in den Griff bekam, würde sie merken, dass etwas nicht stimmte.
„Soll ich schon mal den Tisch decken?“, fragte Ella und sah mich erwartungsvoll an.
Ich nickte, dankbar für die Ablenkung, und kämpfte gegen die innere Unruhe an. „Ja, das wäre toll! Danke, Jellybean. Sieh mal dort in der Vitrine nach, dort habe ich vorhin das Geschirr entdeckt.“
Ich deutete auf eine Glasvitrine, welche zwischen Küche und Esszimmer stand, und machte anschließend mit der Zubereitung des Abendessens weiter. Plötzlich kam mir eine Idee und ich grinste meine Tochter an.
„Vergiss den Tisch“, sagte ich stattdessen. „Wir machen uns einen gemütlichen Sofa-Pizza-Abend. Mein Laptop ist oben im Schlafzimmer, wir könnten uns auf Netflix gemeinsam einen Film aussuchen.“
„O ja, cool!“
Ich lachte, als Ella vor lauter Aufregung einen kleinen Freudentanz aufführte. Schnell rannte sie die Treppe hinauf in den oberen Stock und ich hoffte auf eine stabile Internetverbindung.
Der Duft der frischgebackenen Pizza erfüllte das Strandhaus und das Wasser lief mir im Mund zusammen. Mithilfe eines Pizzarollers schnitt ich die Pizza in handgerechte Stücke und verteilte sie auf zwei Teller, als es an der Tür klingelte. Mein Blick wanderte zu der großen Vintage-Uhr, welche über der Arbeitsfläche hing. Es war bereits spät und wir erwarteten keinen Besuch. Plötzlich wanderten meine Gedanken zurück in die Bellbird Hall und mein Magen zog sich krampfhaft zusammen. Die Bewohner der Bucht waren mir gegenüber nicht gerade aufgeschlossen gewesen und egal, wer dort vor der Tür auf mich wartete, ich würde vorsichtig sein. Es klingelte erneut und ich löste mich aus meiner Starre. Nachdem ich mir noch kurz die Hände gewaschen hatte, machte ich mich auf den Weg zur Tür. Nervös drückte ich die Klinke nach unten und wäre beinahe zurückgestolpert, als ich den unangemeldeten Besucher erkannte.
Für einen Moment vergaß ich, wie man atmete, denn es war dieser unverschämt gut aussehende Idiot aus dem Restaurant. Obwohl es sich draußen nun deutlich abgekühlt hatte, trug er weder eine Jacke noch etwas anderes, um sich warm zu halten. Ich starrte ihn an. Der hatte mir gerade noch gefehlt.
„Hallo“, sagte er mit tiefer Stimme und einem schiefen Lächeln auf den Lippen, das unfassbar charmant auf mich wirkte und meine Knie zum Zittern brachte.
Warum hatte er nur so eine heftige Wirkung auf mich? Mein Herz stolperte und ich verfluchte meinen Körper bereits zum zweiten Mal an diesem Tag. Ich musste mich zusammenreißen. Scheißegal, wie attraktiv er war, ich wollte ihn nicht hierhaben. Ich wollte ihm gerade die Tür vor der Nase zuschlagen, als er seinen Fuß nach vorne schob und seine Hand vorsichtig, aber bestimmt, gegen die Tür presste. Er war deutlich stärker als ich und ich hatte keine Ahnung, ob mir diese Aktion Angst machte oder mich anmachte.
„Bitte, hören Sie mir zu“, beeilte er sich zu sagen und drückte noch etwas fester. „Ich möchte mich bei Ihnen entschuldigen.“
Genervt stöhnte ich auf, gab den Widerstand auf und öffnete die Tür einen kleinen Spalt. Alles in mir war in Aufruhr und ich wusste nicht, was ich tun sollte. Ein winziger Teil von mir wollte ihm tatsächlich zuhören, doch der andere, eindeutig größere Teil, wollte ihn ohne Rückfahrticket auf den Mond schießen.
„Nehmen Sie Ihren Fuß da weg, verdammt noch mal“, zischte ich ihn zwischen zusammengebissenen Zähnen an. Er machte mich nervös und das gefiel mir ganz und gar nicht. „Fuß weg, oder ich rufe die Polizei!“
Sein Blick änderte sich schlagartig und er hob beschwichtigend die Hände. Dabei konnte ich erneut einen Blick auf seine muskulösen Arme erhaschen.
„Es tut mir leid, ich wollte Sie nicht erschrecken.“
Prompt zog er seinen Fuß zurück und nahm die Hand von der Tür. Eine ganze Weile sagte niemand etwas. Ich spürte seinen Blick auf mir und registrierte, wie meine Aufregung von Sekunde zu Sekunde immer größer wurde. Meine Nägel gruben sich in meine Unterarme und meine Knie wurden weich. Vielleicht sollte ich doch lieber die Polizei rufen, schon allein wegen Ella. Vielleicht war dieser Typ ein gesuchter Axtmörder oder so etwas. Der Mann holte gerade Luft, um etwas zu sagen, als sein Blick auf etwas hinter mir fiel. Ich drehte mich um und sah meine kleine Tochter im Flur stehen. Ella trug ihr liebstes Kuscheltier auf dem Arm und beobachtete uns neugierig.
„Wer ist das, Mum?“, fragte sie und kam näher, ohne uns aus den Augen zu lassen.
Ella war schon immer sehr neugierig und aufgeweckt gewesen. Es interessiere sie, was um sie herum vorging. Ich ging vor ihr auf die Knie und strich ihr eine lose Strähne ihres dunklen Haares aus dem Gesicht. Deutlich spürte ich den Blick des Mannes in meinem Rücken und nahm ein elektrisierendes Gefühl wahr, das mich dabei durchflutete.
„Hast du dir schon einen Film herausgesucht?“, fragte ich und Ella nickte aufgeregt. Ich wandte mich an unseren ungebetenen Gast. „Warten Sie hier, ich bin gleich wieder da.“
Ich brachte meine Tochter ins Wohnzimmer, und während mein Laptop hochfuhr, holte ich die beiden Teller aus der Küche und stellte sie auf den modernen Couchtisch. Ella hatte sich für den Film Frozen entschieden, den ich vor unserer Autofahrt bereits heruntergeladen hatte.
„Möchtest du schon mal ohne mich anfangen? Ich komme, so schnell ich kann. Falls du etwas brauchst, ich bin hier, okay?“
„Kein Problem“, sagte Ella und machte sich auf dem Sofa breit. Ich startete den Film und kehrte zu dem Mann zurück, der an der Haustür auf mich gewartet hatte.
Ich bemerkte seinen überraschten Blick. „Was?“
„Ihre Tochter?“, fragte er ungläubig und musterte mich erneut von oben bis unten.
Ich kannte diesen Blick. Es war kein anzüglicher Blick, sondern der Bist-du-nicht-eigentlich-viel-zu-jung-um-Mutter-zu-sein-Blick. Im Laufe der Zeit hatte ich mich daran gewöhnt, denn Menschen reagierten sehr unterschiedlich, wenn es um minderjährige, alleinerziehende Mütter ging. Von Bewunderung über Ausgrenzung bis hin zu Unglauben und Häme hatte ich schon alles erlebt. Meine Mum hatte mir einmal gesagt, dass es mir egal sein müsste, was die Leute über mich dachten, und mittlerweile war es mir das auch. Was vielleicht auch daran lag, dass ich keine sechzehn Jahre alt mehr war. Ich war stolz auf mich und meine kleine Familie, denn ich hatte eine wundervolle Tochter und stand selbst mit beiden Beinen fest im Leben, was nicht jeder von sich behaupten konnte.
Der Mann im Türrahmen räusperte sich kurz und holte mich damit in die Gegenwart zurück. Ich hatte mich schnell wieder gefangen und antwortete ihm äußerst widerwillig. „Sagte ich doch bereits, oder nicht?“
In der Bellbird Hall hatte ich bereits kurz von Ella gesprochen, also war das keine allzu neue Information. Ich beobachtete ihn aufmerksam und bemerkte, wie er das Gesicht kaum merklich verzog. Offensichtlich fühlte er sich vor den Kopf gestoßen und ein kleiner Teil von mir, wollte sich für meine bissige Antwort entschuldigen. Doch dazu kam es nicht.
„Ja, das stimmt.“ Erneut kehrte diese unangenehme Stille zwischen uns wieder zurück.
„Also gut, ich ähm ...“ Er räusperte sich erneut. „Ich wollte Ihnen nur das Handy zurückbringen. Sie haben es im Restaurant vergessen.“
Ich zögerte kurz und nahm das Smartphone schließlich entgegen. Für einen Augenblick berührten sich unsere Hände und ich zog meinen Arm schnell wieder zurück. Diese Berührung war so flüchtig gewesen, dass ich mir gar nicht mehr sicher war, ob ich sie mir nicht nur eingebildet hatte.
„Danke.“ Das war alles, was ich im Moment herausbekam. Nervös knabberte ich auf meiner Unterlippe herum, als ich merkte, dass er mich beobachtete. „Sonst noch etwas?“, fragte ich schließlich und hoffte, dass er noch irgendetwas sagen würde.
„Nein, das war alles“, antwortete er. „Gute Nacht.“
Ich runzelte die Stirn und öffnete meinen Mund, ohne jedoch etwas zu sagen. Was war das denn jetzt? Ich wollte die Tür gerade wieder schließen, als er sich erneut umdrehte und mit schnellen Schritten auf mich zukam.
„Warten Sie, bitte“, sagte er und dieses Mal lag eine feste Entschlossenheit in seiner Stimme. Diese Seite an ihm gefiel mir schon besser. „Mein Auftreten im Restaurant und alles, was ich Ihnen an den Kopf geworfen habe, war nicht in Ordnung.“
Er wirkte aufrichtig und ich hegte keinerlei Zweifel an seiner Entschuldigung. Ich wollte ihm verzeihen, aber er hatte mich mit seinen Worten mehrfach tief verletzt. Wieder sah ich ihm fest in die Augen, fixierte seinen Blick und ignorierte das prickelnde Gefühl, das ich daraufhin in meinem Unterleib verspürte. Ich war keine sehr nachtragende Person, aber er verdiente es, noch ein kleines bisschen länger zu schmoren.
„Schon gut, wirklich.“
Überrascht bewegten sich seine Augenbrauen nach oben. Er wirkte erleichtert und schien sich augenblicklich zu entspannen.
„Danke, wirklich. Ich bin eigentlich ein ziemlich charmanter Kerl, das können Sie mir glauben.“
Und das tat ich auch, ohne Zweifel. Ich wusste nicht, was dieser Mann an sich hatte, doch in diesem Moment war er kein ganz so großes Arschloch mehr, wie ich es erwartet hatte. Zudem sah er so unfassbar gut aus, dass mir beinahe schwindelig wurde. Ich konnte nicht mehr klar denken.
„Danke“, sagte er plötzlich und ich riss die Augen auf. Meine Wangen brannten und ich wäre am liebsten im Erdboden versunken.
Hatte ich meine Gedanken etwa laut ausgesprochen?
Ich schluckte, als er Schritt für Schritt auf mich zutrat. Sein Duft nach Salz und Meer schlug mir entgegen, den ich tief in mir aufnahm. Ich widerstand dem Drang zurückzuweichen. Mittlerweile standen wir uns so nah gegenüber, dass mir das Atmen immer schwerer fiel. Mit rasendem Herzen beobachtete ich, wie er seine rechte Hand hob, die ich schon bald unter meinem Kinn spürte. Diese sanfte Berührung jagte mir einen Schauer nach dem anderen durch den Körper und eine Gänsehaut breitete sich auf meinen Armen aus. Sein Daumen strich sanft über meine Wange und fuhr anschließend die Umrisse meiner Lippen nach. Ich sollte zurück in die Küche gehen, sollte die Pizza fertigmachen, sollte, sollte, sollte. Und doch blieb ich wie angewurzelt stehen.
„Vielleicht“, er räusperte sich wieder, dennoch blieb seine Stimme so rau, dass sie mich mitten ins Herz traf und dafür sorgte, dass ich meine Oberschenkel fest aneinanderpresste, „vielleicht gibt es ja etwas, womit ich mein Verhalten wieder gutmachen kann?“
War das hier ein Traum oder passierte das gerade wirklich? Mein Herz schlug in einem ungesunden Tempo und meine Finger zuckten in seine Richtung, verweilten jedoch noch an meinem Körper.
Sollte ich es tun? Sollte ich es wagen und einen wildfremden Mann küssen, dem ich bis vor wenigen Stunden noch die Pest an den Hals gewünscht hatte? Aber wahrscheinlich war das hier das letzte Mal, dass wir uns so gegenüberstehen würden, also was könnte schlimmstenfalls passieren?
„Du kannst dich jederzeit zurückziehen“, wisperte er, hörte aber nicht auf, die Konturen meines Gesichts nachzuzeichnen. Seine Berührungen jagten mir einen Schauer über meinen Körper und ich wünschte mir, er würde nie wieder damit aufhören. „Ich weiß nicht, was Sie mit mir machen, aber Sie rauben mir den Verstand.“
Ich schnappte nach Luft und spürte, wie ich bei seinen Worten feucht wurde. Seine Pupillen waren vor Erregung stark geweitet. Sie fixierten mich, ließen mich nicht wieder los und ich stellte mir immer wieder dieselbe Frage: Wollte ich das? Und plötzlich wurde mir klar, dass ich die Antwort darauf schon längst kannte. Mein Körper schrie sie mir aus jeder einzelnen Pore entgegen.
Entschlossen reckte ich mich ihm ein Stück entgegen, überbrückte damit den Abstand zwischen uns und legte meine Lippen auf seine. Sein Duft nach Meer und Mann hüllte mich vollständig ein. Seine Lippen waren rau und streiften mit genau der passenden Härte über meine. Leidenschaftlich und doch behutsam erwiderte er meinen Kuss, legte eine Hand an meine Taille, die andere vergrub er in meinem Haar. Ich öffnete meinen Mund und teilte seine Lippen mit meiner Zunge. Der Kuss gewann an Intensität und ich spürte ein unnachgiebiges Ziehen in meinem Unterleib. In diesem Moment ließ ich mich komplett fallen und seufzte in unseren Kuss hinein. Er presste mich noch enger an sich und für einen kurzen Moment dachte ich daran, wie verrückt das alles hier war. Verrückt und doch wahnsinnig heiß. Ich wollte mehr, er wollte mehr und das Feuer in uns kochte immer weiter hoch. In diesem Moment gab es nur noch ihn. Er war einfach überall. Der Mann schlang seine Arme um meine Oberschenkel und hob mich in einer fließenden Bewegung hoch. Dort, wo er mich berührte, spürte ich eine glühende Hitze, die meinen Körper flutete. Seine Berührungen brannten sich in meine Haut und ich seufzte wohlig auf. Er ging mir unter die Haut und rauschte durch meine Venen. Es war absurd, doch in diesem Augenblick brauchte ich ihn wie die Luft zum Atmen.
„Warten Sie, die Tür“, flüsterte ich und versuchte, hinter mich zu greifen. Er lehnte sie sachte an, sodass ich Ella im Notfall noch hören konnte. Doch den Stimmen von Anna und Elsa nach zu urteilen, war meine Tochter vollkommen in der eisblauen Welt der Eiskönigin gefangen.
Ich spürte seine Lippen an meinem Hals, während meine Hände die Haut unter seinem T-Shirt erkundeten. Seine Anwesenheit war zu viel und doch viel zu wenig. Mein Körper rieb sich an seinem und ich spürte, wie sich mein Unterleib vor Lust zusammenzog. Ich wollte ihn schmecken und jeden Zentimeter von ihm erkunden. Er war einfach viel zu verlockend.
„Möchten Sie mehr?“, flüsterte er mit kratziger Stimme und ich konnte hören, wie er um Beherrschung rang. Sinnlichkeit schwang in seinen Worten mit und raubte mir den Atem. Mein Körper stand in Flammen und ich drohte, jeden Moment durchzudrehen.
„Ist es verrückt, wenn ich Ja sage?“
„Ziemlich verrückt.“ Er grinste und meine Mundwinkel zuckten ebenfalls nach oben. „Aber damit komme ich schon klar.“